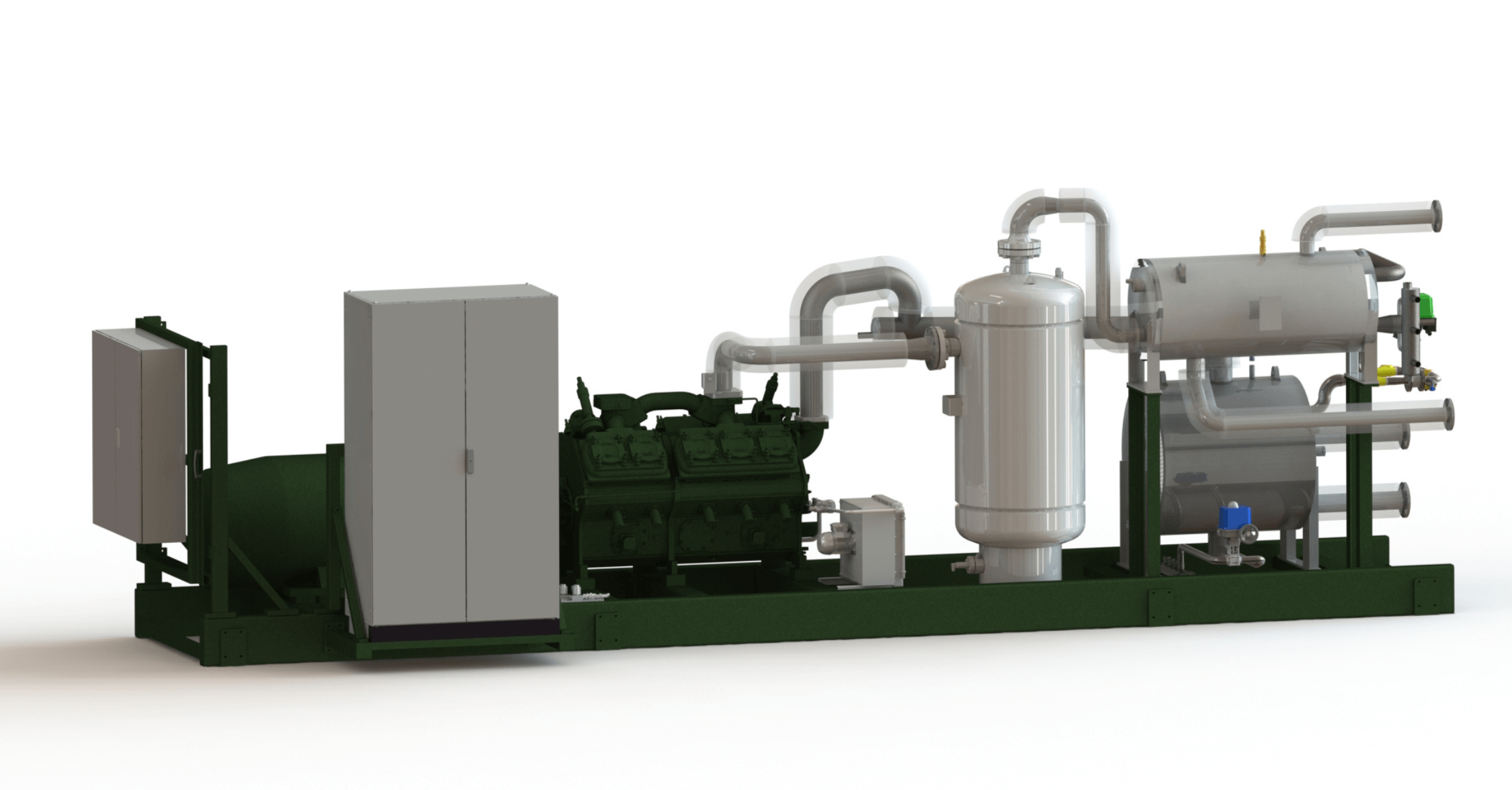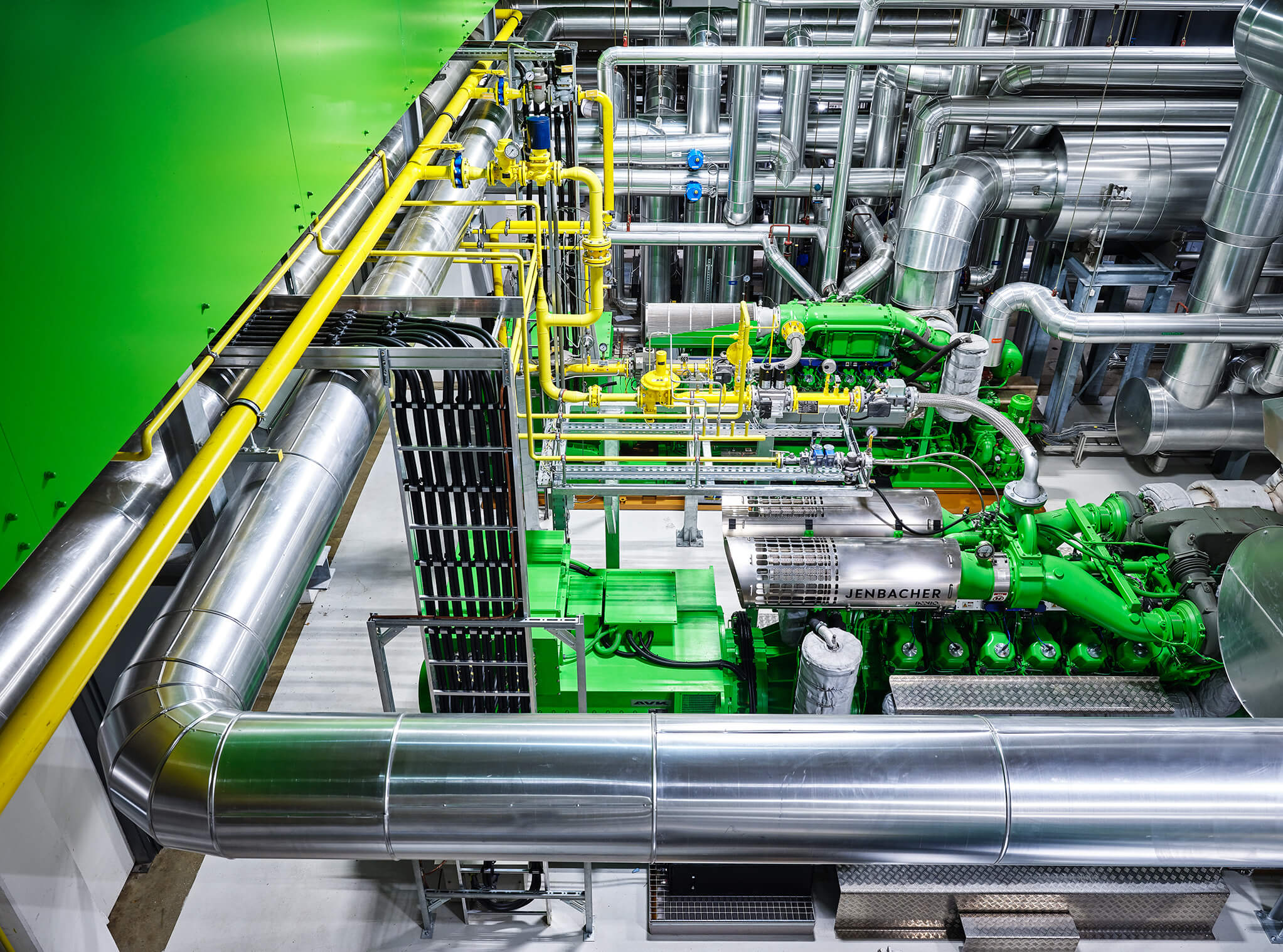Die Energiewende muss nicht nur gewollt, sondern auch umsetzbar sein. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Gebäudetechnik auf den optimierten Einsatz fossiler Energieträger fokussiert. Eine kurzfristige Energiewende im Gebäudebestand ist daher ebenso ambitioniert wie der Umbau aller aktuell genutzten Kraftfahrzeuge auf alternative Antriebssysteme.
Gesetze und Vorschriften allein reichen jedoch nicht aus, um Veränderungen rasch herbeizuführen. Fördermaßnahmen können dabei unterstützend wirken und Prozesse in Gang setzen, doch die Ergebnisse müssen am Ende wirtschaftlich, einfach nutzbar und ökologisch sinnvoll sein. Das Ziel: eine Ausrichtung auf eine regenerative und volatile Energiezukunft.
So einfach das formuliert werden kann, so schwierig ist es, dies in der Praxis umzusetzen. Alle Gebäude sind Unikate – mit spezieller technischer Gebäudeausrüstung, individuellen Nutzungsprofilen und in der Regel nicht für einen netzdienlichen Betrieb oder eine volatile Energieversorgung ausgelegt. Zudem bleibt oft unklar, woher die benötigte regenerative Energie kommt und wie sie bis an die Gebäude herangeführt werden soll.